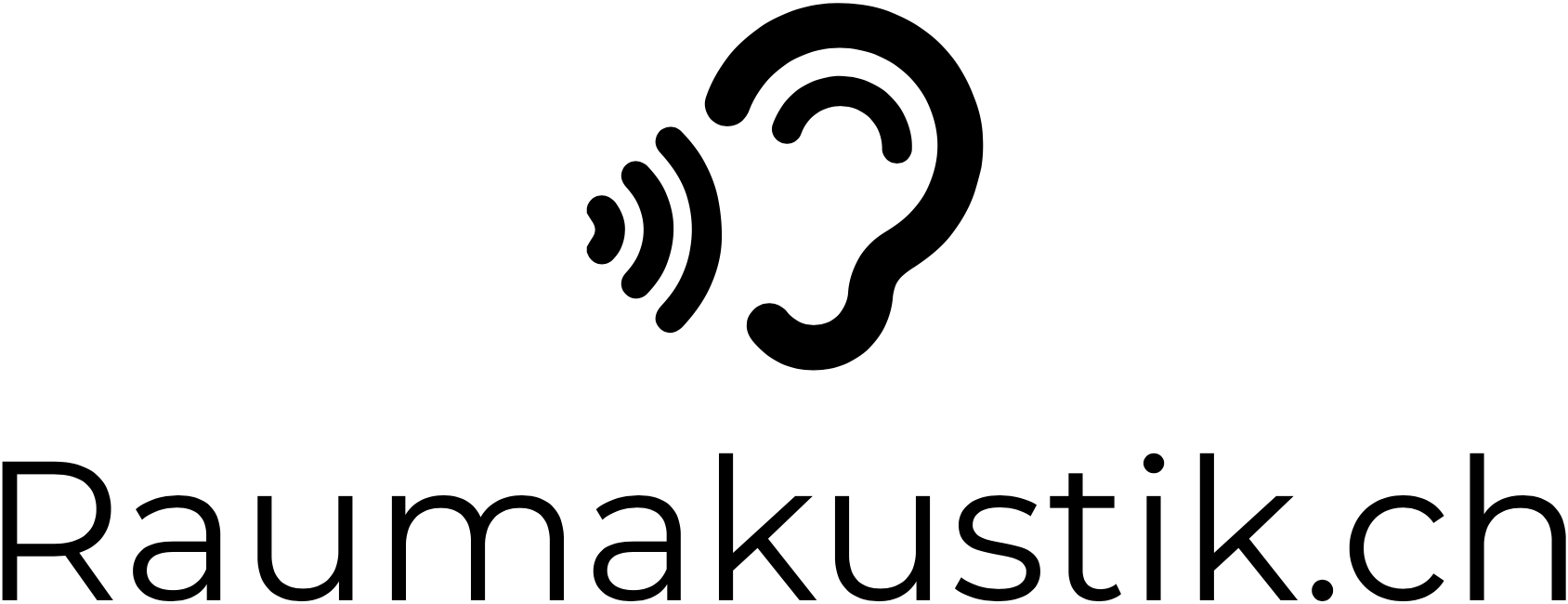Jazzcampus Basel «nicht improvisiert»
Foto © Hochparterre | Georg Aerni - Der Performance-Saal ist eine Probebühne in drei verschiedenen Schwarztönen.
Quelle: Hochparterre | Text: Axel Simon
Der Jazzcampus Basel erfüllt seinen Musikerinnen alle Wünsche. Die Räume schmeicheln den Ohren, den Augen aber verweigern sie sperrig die Harmonie.
Giebel zeigen in den engen Himmel. Erker und Balkone ragen malerisch in die Gasse. Unter gemauerten Bögen lodert ein Kaminfeuer. Zunächst scheint es, als hätte sich eine mittelalterliche Szenerie in den Kleinbasler Hinterhof verirrt. Dann drehen sich die Assoziationsschlaufen weiter: klassisch-symmetrische Fassaden, metallisch-glänzende Fensterrahmen, Erker aus derbem Beton, umgeben von handgestrichenen dänischen Ziegeln. Kaum haben sich die Bilder im Kopf irgendwo zwischen postmodernem Feriendorf in Südfrankreich und der rekonstruierten Fussgängerzone einer mitteldeutschen Kleinstadt eingependelt, da erinnert die blanke grüne Dachpappe an den Materialminimalismus der frühen Herzog & de Meuron. Ja, was denn nun?
Es ist nicht das erste Mal, dass uns die Architekten Lukas Buol und Marco Zünd in Erklärungsnot bringen. Ein- deutiges lehnen sie ab, Irritation ist ihr Programm. Vor rund zehn Jahren klonten sie aus den Ziegelbögen einer kleinen Fabrik in Basel neue Wohnbalkone, in Binningen erweiterten sie ein historisches Haus mit einer Kopie seiner selbst, und beim Musikerwohnhaus in der Nähe des Novartis Campus könnte der Kontrast zwischen den grossbürgerlichen Innenräumen und dem äusseren Brutalo-Betonskelett kaum grösser sein. Bei ihrem bisher grössten Projekt, dem Jazzcampus an der Utengasse in Basel, setzen Buol & Zünd noch einen drauf. Sie bedienen sich historischer Bauformen, um daraus Neues zu schaffen – lustvoll und hemmungslos, emotional und unberechenbar. Marco Zünd formuliert es so: «Wir entwerfen keine heroisch-modernen Konzepte. Wir mögen die Vielschichtigkeit des Widersprüchlichen, die den Nutzer mit seinem Haus verbindet.» Doch ein Besuch des neuen Hauses zeigt: Das hakenschlagende Zitieren der Architekten verlangt den Nutzern auch einiges ab. Einmal gerufen, so scheint es, drohen ihre Referenzen wie bei einem Zauberlehrling ausser Kontrolle zu geraten.
Malerische Maschine
Auf dem Jazzcampus machen Schülerinnen und Schüler ihre ersten Schritte in diese Musikrichtung, und Studierende lernen, miteinander zu spielen, aber auch ihre Musik zu produzieren und zu vermarkten. Wo vorher die beiden schnurgeraden Zeilen einer Maschinenfabrik stan- den, scharen sich nun ein Dutzend schmaler Häuser um einen bewegten Gassenraum. Nur zwei von ihnen sind alt. Der Neubau an der Strasse trägt die rekonstruierte, braun verputzte Fassade seines Vorgängers. Die anderen rücken wie auf einer Bühne zusammen, einprägsam und unwirk- lich wie das Modell einer Idealstadt. Der Boden des Hofes steigt an, Bogen und Erker sind links und rechts ins Bild gerückt, und die Firste der steilen Dächer weisen alle in eine Richtung. Eine gelbe Ziegelhaut prägt die Szenerie und betont so das Kulissenhafte. Eine stark geschminkte Julia könnte auf dem Balkon erscheinen, eine Dutzendschaft der Feuerwehr hier Abseilen und Löschen üben. Diese Bühne ist ein starkes Bild. Doch wofür steht es?
Aufnahmesaal - Selbst ein vorbeifliegender Helikopter ist hier nicht zu hören. Foto © Roland Schmid -
Hinter diesem Bild verbirgt sich eine grosse Maschine. Das gesamte zweite Untergeschoss des Jazzcampus ist mit Technik gefüllt, vor allem mit Lüftungsanlagen, die jeden der 49 Musikräume einzeln ansteuern, damit die probenden Musiker sich nicht gegenseitig stören. Vor allem bei den Aufnahmestudios reiht sich Schicht an Schicht zu bis zu meterdicken Wänden. Den grossen Saal daneben baute man als ‹Haus im Haus› unter eines der Dächer, damit selbst der Helikopter des nahen Kinderspitals da- rin nicht zu hören ist. Die Höhe der Baukosten behalten die dahinterstehenden Stiftungen von Beatrice Oeri für sich. Geld kann hier kaum eine Rolle gespielt haben.
So viel Aufwand für Jazz? Für eine Musikform, die man eher mit feuchten Kellern und rauchigen Clubs verbindet als mit komfortablen Konzerträumen? Bernhard Ley ist entschieden: «Wir haben die gleichen Qualitätsansprüche wie die Klassik. Warum sollen wir uns mit schlechteren Räumen zufriedengeben?» Der Jazzschulleiter ist stolz auf sein neues Reich. Auf dem Weg dahin haben er und die Architekten drei Jahre lang ‹geforscht›, auf Reisen Musikhäuser angesehen und -gehört. «Die Vorstellung, was ein guter Raum sei, ist von Musiker zu Musiker unterschiedlich», sagt Ley. Sie lernten, dass sich die Akustik über flexible Absorber nicht kontrollieren lässt, und entschieden sich daher für Variabilität: Möglichst viele unterschiedliche Räume wollten sie bauen, um den verschiedenen Vor- stellungen der Jazzer gerecht zu werden. Zurück in Basel liessen sie Studierende zwei Musterräume bewerten. An einem Workshop am Bielersee sammelten die Musiker Wünsche. Möglichst intuitiv beschrieb jeder das Ausse- hen seines ‹Musiktraumzimmers›. Lukas Buol nennt als gemeinsamen Nenner ein «Berliner Hinterhofzimmer». Diesem Bild eines wohnlichen und persönlichen Raums versuchten die Architekten in ihrem Entwurf möglichst nahe zu kommen. Und dabei die massiven Ansprüche der Akustik nicht dominant werden zu lassen.
Stimmungsdimmer
49 Übungsräume stehen den Schülern und Studen- tinnen im Jazzcampus zur Verfügung. Die unterschiedlichen Grössen und Formen entstanden durch die Teilung der Anlage in einzelne Häuser mit Satteldächern. Waren deren Wände nicht ohnehin schon schief, drehte man sie aus dem rechten Winkel. Ein Wandtäfer aus gestrichenen Holzstäben rückt die verschiedenen schallabsorbierenden oder schwingenden Oberflächen in den Hintergrund und rhythmisiert die Wände. Pastellene Farbigkeit, rötlich, bläulich oder gelblich, schiebt den Raumcharakter noch etwas weiter Richtung Biedermeier. Keine Wand-, keine Deckenstruktur, die Buol & Zünd nicht entworfen hätten. Keine Oberfläche überliessen sie dem Zufall. Improvisation ist das genaue Gegenteil ihres Vorgehens. Auch die Pendelleuchte ‹Sombrero› entwickelten sie. Als Stim- mungsdimmer strahlt sie von weich bis neonhart nach oben, nach unten und aus sich heraus, alles kombinier- bar. An der Decke ersetzt eine weisse Abfolge schmaler und breiter Holzleisten den Berliner Hinterhofstuck. Der Wunsch nach Streuung des Schalls trifft dort denjenigen nach einer lebhaften Oberfläche. Ästhetik und Akustik kommen zusammen.
Einen Grossteil der Musikräume prägt diese Wohn- lichkeit mit raumhohen weissen Vorhängen. Die Räume, in denen man auch die Öffentlichkeit empfängt, haben jeder einen anderen, kräftigen Charakter. Genau unter dem Hof liegt das Foyer des Jazzcampus. Da gelangt man zur Garderobe und, über die beiden Haupttreppenhäuser, nach oben. In den Wänden dieser Halle öffnen sich eigenartige Bögen, mal breit, mal spitz, gefüllt mit Holz und Glas. Dort,wo die Bögen in die Decke schneiden, laufen sie als Tonnengewölbe quer durch den Raum. Die weiteren Sonderräume sind über die Häuser verteilt: der Club an der Strasse mit violettem Akustikrelief auf nachtblauen Wänden, der feurig-rote Regieraum des Tonstudios, der hohe Performancesaal in drei verschiedenen Schwarztönen mit Thermenfenster, der grosse Konzertsaal als Eichenschatulle, unter deren Giebeldecke das Walskelett eines weissen Akustikgebildes schwebt. Verlässt man diese schönen Räume, hallt ihre Stimmung jedoch nicht lange nach. Kalte Neutralität umgibt den Gast in den Treppenhäusern, Beton und weiss gestriche- nes Jutegewebe. In den WC-Räumen findet er sich in einer den Achtzigerjahren entsprungenen, braun gesprenkelten Kachelwelt wieder. Der Gang durch die Campusräu- me gleicht einem Wechselbad der Stimmungen – mal harmonisch, mal provokativ hässlich. Wie bei der äusseren Erscheinung der Gebäude gehen die Architekten auch im Inneren vor: Brüche haben sie nicht geglättet, sondern gesteigert. Die unterschiedlichen Welten fügten sie nicht komplementär zu einem Ganzen, sondern stellten sie kontrovers und sperrig nebeneinander – Dissonanzen, die durch den hohen Nutzungskomfort und die perfekte Bau- qualität noch gesteigert werden. Verstört und inspiriert zugleich tritt man vom Hof des Jazzcampus auf die Strasse. Ein Gebäude, das so etwas schafft, ist grossartig.